
Es war ein herrlicher Herbsttag. Bei strahlendem Sonnenschein fuhr ich auf der Karl-Marx-Allee mit dem Fahrrad zur Arbeit und freute mich schon jetzt auf unsere Mittagspause, wo ich mich zusammen mit meiner lieben Kollegin Henna für eine Stunde in den kleinen Park gegenüber legen und die vielleicht letzten wärmenden Strahlen des Jahres genießen würde.
Als ich an den zehngeschossigen Hochhäusern kurz hinterm Kino International vorüberkam, fiel mir etwas auf: An einem Fenster im fünften Stock eines der riesigen Betonblocks wehte eine einsame Fahne im Wind: eine DDR-Fahne. Ich fahre hier jeden Tag entlang und grübelte beim Weiterfahren, warum ausgerechnet heute jemand trotzig diesen alten Stofffetzen gehisst hatte. Kurz hinter dem Fernsehturm fiel der Groschen dann endlich. Heute war nicht irgendein belangloser Oktobertag. Es war der 7. des Monats, ein Tag, den ich eigentlich nicht so schnell hätte vergessen dürfen: Der 7. Oktober, der Gründungstag der Republik, war einer der wenigen gesetzlichen Feiertage in der DDR – der vielleicht wichtigste zudem.

Wir freuten uns eigentlich immer riesig auf freie Tage: Frei haben, das hieß lange ausschlafen, gemütlich frühstücken und gemeinsam an den Müggelsee fahren, wo es für alle ein „Steak au four“ in dem großen Gartenlokal mit den gemütlichen Holzstühlen am Wasser gab und nach einem kurzen Spaziergang in den Wäldern der Müggelberge noch ein Stück Kuchen oder ein Eis aus der Diele. Für den Vati gab es dann immer noch ein kühles Bier vom Fass für eine Mark und zwei.
Dazu ist es am 1. Mai und am 7. Oktober jedoch nie gekommen. Stattdessen hieß es für fast alle: früh aufstehen, am Genossen Erich Honecker vorbei über die Karl-Marx-Allee marschieren oder vor der Parade Spalier stehen. Das war unsere erste Bürgerpflicht.
Als wir noch mit unserer Mutti, genau wie am 1. Mai, in der Brigade mitmarschierten, fanden wir es immer ganz toll, den Erich mal „in echt“ zu sehen. Ich stritt mich sogar mit Benny darüber, wen er angelächelt oder wem er gar zurückgewunken hatte. In der Aktuellen Kamera achteten wir abends darauf, ob wir irgendwo zu sehen waren. Wir hofften jedes Jahr wieder, dass sie ausgerechnet uns gefilmt hätten.

Vater ging nach der Parade immer in seine Stammkneipe, das „Scheppert-Eck“, und überließ uns unserem Schicksal. Spätestens ab der 3. Klasse waren 1. Mai und der Geburtstag der DDR allerdings nicht mehr ganz so lustig. Obwohl die riesige Ehrentribüne nicht weit von unserer Wohnung stand, wurden wir zu unmenschlichen Zeiten geweckt, um pünktlich an der Sammelstelle unserer Schulklasse am Frankfurter Tor zu sein. Betriebsgruppen, Brigaden und Schulklassen trafen sich lange, bevor die Parade losging, an dieser riesigen Straßenkreuzung mit Blick auf die endlose Karl-Marx-Allee. Dann hieß es: Ruhe bewahren, abwarten und frieren. Leider waren wir eine DDR-Vorzeigeschule, denn während andere Kinder nur am 1. Mai selbst marschierten und am 7. Oktober lediglich den vorbeifahrenden Panzern, den Grenztruppen und Kampfgruppen der NVA mit Elementen in der Hand zuwinken mussten, bevor sie nach Hause liefen, war für uns noch lange nicht Schluss. Wir hatten die Ehre, so lange zu bleiben, bis auch die letzte Einheit im Gleichschritt vorbeistolziert war, durften sämtliche sozialistischen Brigaden mit ihren Losungen und die FDJ-Züge abwarten, bis unser Klassenlehrer, Herr Blase, endlich brüllte: „Klasse 5b sofort in Zweierreihen aufstellen. Es geht los!“
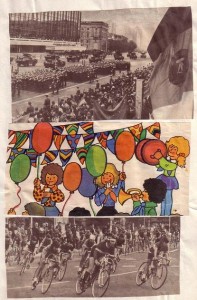
Zentimeterweise stolperten wir vorwärts, inmitten von Hunderttausenden Berlinern. Es dauerte dann mehrere quälende Stunden, bis wir endlich diese trostlose Tribüne der alten Genossen erreichten, die ihrem Fußvolk – also uns – mühsam zuwinkten. Trotzdem war es eine Erlösung, schließlich am dauergrinsenden Erich Honecker mit seinem dicken grauen Mantel vorbeizumarschieren. Glückshormone wurden freigesetzt, denn jeder wusste: Jetzt habe ich es geschafft! Die tollen Panzer und die beeindruckend im Stechschritt laufenden Grenztruppen waren hier längst schon vorbeigezogen, und als auch wir vor den Herrschaften endlich sozialistisch salutiert hatten, entließ uns Herr Blase und wir standen verloren am Alex herum und überlegten uns, was wir mit dem Rest des Tages anfangen sollten. An unserem wichtigsten Feiertag waren die extra errichteten Buden und Verkaufsstände rund um den Alex jetzt heillos überfüllt, genau wie der Ketwurststand gegenüber vom Warenhaus. Mit platten Füßen kamen wir am späten Nachmittag nach Hause und waren trotz der Grilletta, für die wir uns stundenlang angestellt hatten, hungrig. So ging das jedes Jahr am 1. Mai und am 7. Oktober.

Allerdings gab es auch Ausnahmen: 1985 erzählte ich meinen Eltern am Abend vor der großen Parade, dass sich unsere Klasse am nächsten Tag erst später treffen würde. Alles lief nach Plan. Ich wachte gegen 11.30 Uhr auf – meine Eltern und Benny marschierten längst auf der Karl-Marx-Allee. Ich legte mich vor die Glotze und schaltete zwischen ARD und ZDF hin und her. So stellte ich mir als 14-Jähriger einen Feiertag vor!
Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass mein Vater genau an diesem Vormittag auf der riesigen Demonstration ausgerechnet meinen Klassenlehrer Blase traf, zusammen mit meiner fast vollzähligen Schulklasse. Ich war der einzige, der fehlte. Ich war ziemlich überrascht, als er gegen Mittag mit krebsrotem Kopf vor meiner gemütlichen Couch stand. Ich hatte meinen Alten selten so zornig gesehen. Ein Blick in seine Augen reichte aus und ich, das unsozialistische Kind eines Genossen und Majors der Volkspolizei, bekam richtig Angst. Es war zu befürchten, dass er mich aus dem Fenster des 9. Stockes schmeißen würde. Soll ich es Glück im Unglück nennen? Er schnappte nicht mich, sondern meinen schwarzen Annett Kassetten-Rekorder und klatschte diesen mit voller Wucht gegen die Kinderzimmerwand.
Ich stand unter Schock. Er hatte soeben etwas wirklich Wichtiges in meinem Leben zertrümmert und er wusste es. Große Tränen standen mir in den Augen. Keine „Schlager der Woche“ und „Hey Music“ auf RIAS und SFB mehr und die aufgenommenen Kassetten wieder und wieder hören – ich heulte plötzlich wie noch nie im Leben. Dieses unberechenbare Arschloch war nicht mehr mein Vater! Er wusste jetzt, dass er Scheiße gebaut hatte und auch, was er mir sechs Monate später als Ersatz für den Annett zur sozialistischen Jugendweihe zu schenken hatte: den nagelneuen RFT-Doppelkassetten-Rekorder für 1.500 Mark. Im Jahr darauf stand ich wieder brav mit meinem Winkelement in der Jubelmenge und huldigte Erich Honecker und seinen Genossen.

Beim letzten 7. Oktober vor dem Mauerfall hatte ich diese Geschichte eigentlich längst vergessen. Dennoch lagen 1989 noch größere Welten zwischen mir und meinem Vater als zuvor. Ich war mittlerweile Abiturient der 12. Klasse mit heiß diskutierenden Mitschülern, die sich in Kirchen trafen, um neue Ideen auszutauschen, kritische Artikel verfassten und zum Teil in geheimnisvolle neue Foren eintraten. Einige waren über Ungarn abgehauen. Mein alter Herr war nach wie vor beim SC Dynamo Sportfunktionär, wo man die Dinge in Ungarn ungern sah.
Die DDR wackelte und unsere Familie gleich mit.
Es war später Herbstnachmittag an diesem Feiertag, ich hatte diesmal wieder ausgeschlafen und traf mich mit Matze, Otmar und Bernd in den letzten Sonnenstrahlen am Alexanderplatz. Die Jungs hatten munkeln hören, dass hier heute etwas los wäre. Was genau, wusste eigentlich niemand. In der Mitte des Platzes in der Nähe der Weltzeituhr versammelten sich allmählich etwa 500 Leute. Es kam mir vor, als hätte sich hier eine Truppe von Rowdys und Krawalltouristen getroffen, die endlich einmal zeigen wollten, dass nicht nur in Leipzig und Dresden die Post abging. Obwohl es ein Samstag war: Dies sollte scheinbar Berlins erste Montagsdemo werden! Die kleine Meute brüllte ununterbrochen: „Schließt Euch an!“ Trotzdem war es weiterhin ein erbärmliches Häuflein – weit entfernt von den Menschenmassen, die angeblich in Sachsen auf die Straße gingen. In Berlin war in dieser Hinsicht am wenigsten los. Warum, konnte ich auch nicht sagen. Ein paar Leute riefen fast schüchtern: „Freiheit, Freiheit“.

Einige rollten Transparente aus, und eine kleine Gruppe begann, neue Parolen anzustimmen. „Gorbi, Gorbi!“, „Gorbi hilf uns!“ und „Wir sind das Volk!“, brüllten sie in der Hoffnung, dass die anderen mit einstimmten. Doch nicht alle folgten der Aufforderung; viele beobachteten die Szenerie nur äußerst aufmerksam. Heute denke ich, dass zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich die Hälfte der Anwesenden die Veranstaltung unterwandert hatte. Genossen vom Innenministerium lagen in Zivil auf den Dächern der angrenzenden Häuser. Ich konnte sehen, dass dort oben mehrere Beobachter mit großen Kameras standen.
Doch auch ohne Handy – also durch den „Buschfunk“ – strömten nach und nach immer mehr Menschen auf den Alex. Angesteckt von meinen Jungs brüllte auch ich mittlerweile: „Schließt Euch an!“ Einige zeigten den Stinke- oder die gespreizten Victory-Finger in Richtung der Aufseher auf den Dächern. Ohne erkennbares Zeichen setzte sich der Tross in Bewegung. Es ging zum Palast der Republik. Aus dem Restaurant „Schwalbennest“ beobachteten uns komische Vögel, und gleichzeitig, in „Erichs Lampenladen“, tagten und feierten die obersten Genossen und eingeladenen Staatsgäste den 40. Jahrestag der Gründung unserer DDR bei voller Beleuchtung.

Auf Höhe der Spree, die wie eine künstliche Mauer vor dem „Palazzo Prozzo“ floss, kamen wir zum Stehen. Vor der Brücke am Nikolaiviertel standen hunderte von Volkspolizisten und riegelten den Zugang ab. Immer lauter wurden die Gesänge und Rufe der Menge. Inzwischen mochten wir schon 3.000 Leute sein. Den Polizisten stand die Angst ins Gesicht geschrieben. Zum ersten Mal trafen in Berlin Staatsmacht und Volk so geballt aufeinander. Keiner wusste, was geschehen würde.
Matze war unser Mann in vorderster Front. Er provozierte und beschimpfte die Arm in Arm eingehakten Beschützer aufs Übelste. Plötzlich begannen er und ein paar andere Kerle, mit voller Kraft gegen diesen menschlichen Wall, der die wenigen Oberen vor ihren vielen Untergebenen schützen sollte, anzurennen. Die ersten Angriffe wurden mit Schlagstöcken abgewehrt. Da ertönte aus dem Pulk der Demonstranten eine Parole in Richtung der Palastwächter, die wie eine doppeldeutige Drohung klang. Sie kam aus mittlerweile tausenden Kehlen: „Wir bleiben hier! Wir bleiben hier! Wir bleiben hier!“ Mir liefen kalte Schauer über den Rücken.
In den Augen der Polizisten sah ich eine bedrohliche Mischung aus Angst und Hass, hinter der ersten Reihe sprang jetzt eine zweite Garde von einem LKW. Diese Jungs hatten große Kalaschnikows in den Händen. Alle Protestierer wichen augenblicklich zurück, und der Kommandeur auf der anderen Seite war plötzlich mit seinen gebrüllten Befehlen wesentlich lauter als die 3.000 Leute des Volkes. Ich spürte, dass sich in diesen Augenblicken die Geschichte unseres Landes entscheiden würde. Und mein Gefühl sagte mir, dass sie gleich in die Massen ballern würden.

Mit schlotternden Knien ging ich zu den anderen und sagte, dass ich nicht hier bleiben würde. Wir sahen uns verängstigt an und keiner nahm es mir übel. Zusammen mit Otmar war ich innerhalb von dreißig Sekunden aus der Gefahrenzone.
Mein Vater war zu gleicher Zeit von seiner Behörde in ständige Alarmbereitschaft versetzt worden, mit Ausgabe von Uniform und scharfer Pistole. So kitschig wie in manchen deutschen Spielfilmproduktionen auf RTL oder SAT1: Wenn es zu einer ernsthaften Eskalation gekommen wäre, hätte ich unter Umständen wirklich meinem Vater gegenübergestanden oder er hätte die wesentlich mutigeren Matze und Bernd erschießen können.
Hat er aber nicht! Und das war die wirklich sensationell gute Nachricht an diesem 7. Oktober 1989. Die Leute, die vor Honeckers Regierungspalast standhaft geblieben waren, hatten den Sieg davon getragen. Die Bilder der wütenden Demonstranten gingen um die Welt und trotz späterer Prügelorgien der Stasi und Volkspolizei und allerlei Festnahmen gab es keinen Schießbefehl und keinen einzigen Toten.

Der Arbeitstag 19 Jahre später ging friedlich vorüber und nichts erinnerte mehr an die Zeit vor so vielen Jahren. Mit meiner Kollegin Henna diskutierte ich lange auf der Wiese, ob man verschwundene Feiertage eigentlich ein Leben lang vermissen würde. So wie eine innere Uhr einen schon immer Wochen vorher spüren lässt, dass bald Weihnachten ist, sticht es bei jedem anständigen Ossi am 7. Oktober im Herzen. Obwohl Henna aus Heidelberg kommt und selbst den 17. Juni verloren hatte, kannte sie dieses Gefühl scheinbar nicht. Auf dem Rücken liegend, schaute sie grübelnd in den strahlend blauen Himmel und fragte mich: „Meinst du denn nicht, dass es auch einen Himmel für verlorengegangene Feiertage gibt und gerade jetzt vor einer rostigen Ehrentribüne zigtausende untote Genossen an einem Honeckerzombie in dickem grauen Mantel vorbeimarschieren?“ Ich rollte mich zu ihr hinüber und rief grinsend: „Henna, Scheppert! Sofort in Zweierreihen aufstellen. Es geht los!“

Weiterlesen kann man in meinem DDR-Buch: „Mauergewinner oder ein Wessi des Ostens“
oder bei
Spiegel Online
